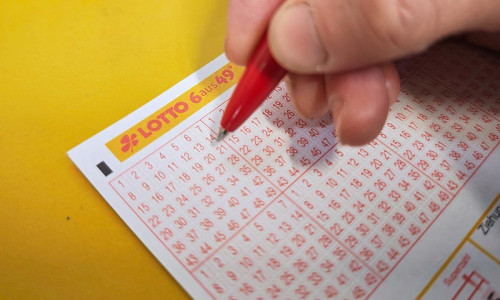Region. Forscher aus verschiedenen Fachdisziplinen der Ostfalia Hochschule, der TU Braunschweig und der TU Clausthal arbeiten an einem gemeinsamen Ziel: einem ganzheitlichen Entwicklungsleitfaden für ein Sicherheits- und Automatisierungskonzept für Landmaschinen (GESAL), der sicherheitstechnische, technologische und rechtliche Anforderungen zusammenführt. Darüber berichtet die Ostfalia in einer Pressemitteilung.
Das interdisziplinäre Vorhaben läuft unter der Gesamtprojektleitung der Ostfalia Hochschule und wird bis Oktober 2027 mit rund 2,7 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt.
Durchführung komplexer Arbeitsprozesse
„Automatisierte Landmaschinen stehen im Zentrum aktueller Innovations- und Transformationsprozesse in der Landwirtschaft. Anders als bei automatisierten Personenkraftwagen liegt der Fokus hier nicht nur auf dem Fahren, sondern auf der Durchführung komplexer landwirtschaftlicher Arbeitsprozesse unter teils schwierigen Umweltbedingungen“, erklärt Projektleiter Prof. Dr. Harald Bachem von der Ostfalia Hochschule.
Die Herausforderungen reichten dabei von technischen Fragen der Sensornutzung und Prozesssicherung bis hin zur Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen, zu denen unter anderem das europäische Produktsicherheitsrecht, das Haftungsrecht sowie das Umweltrecht gehören. Um auf mögliche Hürden bestmöglich vorbereitet zu sein, wird im GESAL-Projekt ein Entwicklungsleitfaden – der so genannte Code of Practice – entwickelt, an dem sich künftig europaweit bei der Automatisierung von Landmaschinen orientiert werden kann.
Hardwaresicherheit automatisierter Landmaschinen
Das Teilprojekt A obliegt der Ostfalia Hochschule, genauer dem Lehr- und Forschungsgebiet Fahrzeugsicherheit (LFF), und befasst sich mit der Hardwaresicherheit automatisierter Landmaschinen. Ziel ist die Entwicklung einer Sensorarchitektur für automatisierte Landmaschinen, die für den zuverlässigen Betrieb der Maschinen sorgt. Hierzu wird ein digitaler Zwilling – ein virtuelles Modell – der Landmaschine in einer Computersimulation erstellt. In dieser Umgebung werden dann verschiedene Sensoren und deren Anordnung getestet und miteinander verglichen. Darüber hinaus werden verschiedene KI-Objekterkennungsmodelle entwickelt, welche sicherheitskritische Objekte, wie zum Beispiel Rehe, unter verschiedenen Störgrößen, wie Staub oder Nebel, sicher erkennen sollen.
Rechtsfragen der Zukunftstechnologie
Das Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge (IMN) und das Institut für Rechtswissenschaften (IRW) der Technischen Universität Braunschweig bilden zusammen das Teilprojekt B. Am IRW werden im Rahmen des Projekts die entscheidenden Rechtsfragen dieser Zukunftstechnologie erforscht. Im Fokus stehen unter anderem das Produktsicherheits-, Haftungs-, Zulassungs- und Umweltrecht sowie die Frage, welche Regeln den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz ermöglichen. Die Ergebnisse dieser Analysen werden veröffentlicht, um einen fundierten Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs zu leisten.
Das IMN betrachtet in dem Projekt die Prozesssicherheit, welche bei der Automatisierung landwirtschaftlicher Arbeitsprozesse eine tragende Rolle spielt. Während Landwirte und Landwirtinnen auf herkömmlichen Traktoren den Arbeitsprozess kontinuierlich überwachen und Prozessparameter anpassen, übernimmt bei autonomen Landmaschinen die Maschine selbst diese Verantwortung. Prof. Dr. Ludger Frerichs vom IMN der TU Braunschweig dazu: „Prozesssicherheit muss zweierlei verstanden werden. Die Prozesse müssen sicher funktionieren, also unter allen Bedingungen die Arbeitsaufgabe richtig durchführen, und sie müssen hinsichtlich der Gefährdung, die von ihnen ausgehen kann, sicher sein.“
Softwaresicherheit automatisierter Landmaschinen
Im Teilprojekt C widmet sich das Institute for Software and Systems Engineering (ISSE) der Technischen Universität Clausthal unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Rausch der Softwaresicherheit automatisierter Landmaschinen. Ziel ist es, ein Sicherheitskonzept zu entwickeln, das den zuverlässigen Betrieb auch bei Störungen – etwa durch GPS-Drift oder unerwartete und unbekannte Hindernisse im Arbeitsumfeld – sicherstellt.
Dafür entwirft das ISSE eine Softwarearchitektur mit klar definierten Bausteinen und Middleware-Lösungen, die eng mit der geplanten Sensor- und Hardwaretechnik verzahnt wird. Die dabei eingesetzten Methoden stammen aus dem Bereich des automatisierten Fahrens von Straßenfahrzeugen und werden gezielt an die Anforderungen der Landwirtschaft angepasst.
Worst-Case-Szenario erarbeitet
„Im ersten Projekthalbjahr konnten wir bereits zahlreiche Schritte für die Entwicklung des Code of Practice umsetzen“, erklärt Ostfalia-Wissenschaftler Bachem. Es wurden europäische Verordnungen – unter anderem die Maschinen-, Daten- und KI-Verordnung – untersucht und daraus konkrete Anforderungen im Anwendungsbereich von automatisierten Landmaschinen abgeleitet. Zudem wird ein Worst-Case-Szenario erarbeitet, anhand dessen sicherheitskritische Einsatzsituationen systematisch betrachtet werden sollen.
Automatisierte Landmaschinen eröffnen laut Projektleiter Bachem erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung, zur Sicherung der Prozessqualität und zur Entlastung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte. „Das ist insbesondere vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels und steigender Anforderungen an Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ein wichtiges Thema“, sagt Bachem.
Verlässlicher Orientierungsrahmen
Zugleich ergeben sich aber mit der Automatisierung grundlegende Herausforderungen in technischer sowie rechtlicher Hinsicht. Daher setzt das Projekt GESAL genau an den Schnittstellen zwischen den Forschungsgebieten an und bezieht die Industrie mit ein. Es zielt darauf ab, die Potenziale hochautomatisierter Landtechnik verantwortungsvoll zu erschließen und gleichzeitig einen verlässlichen Orientierungsrahmen für Forschung, Entwicklung und Regulierung zu schaffen.