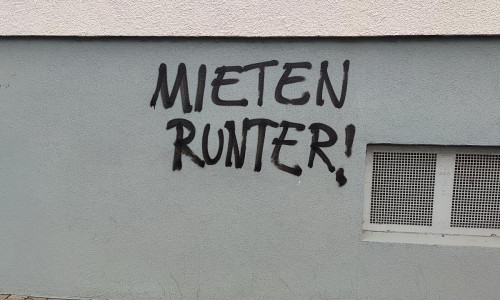Braunschweig. Die Einfriedung der Villa Salve Hospes am Lessingplatz wird ab Juli umfassend restauriert, teilt die Stadt Braunschweig mit. Das Projekt wird von sechs Sponsoren gefördert, die rund die Hälfte der Kosten tragen. Der Bauausschuss hatte im Februar einhellig der Sanierungsmaßnahme zugestimmt.
Sie dient dem langfristigen Erhalt der historischen, denkmalgeschützten Einfriedung der Villa, die vom herzoglichen Baumeister Peter Krahe entworfen und zwischen 1805 und 1808 erbaut wurde.
"Wir konnten sechs Förderer dafür begeistern, das Projekt zu unterstützen", freut sich Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer. "Mit ihrer Hilfe gelingt es, signifikante Bestandteile eines überregional bedeutsamen Baudenkmals zu restaurieren und für die Zukunft zu erhalten. Zugleich sorgen die Förderer mit ihrem finanziellen Engagement dafür, dass für das Projekt nur zur Hälfte öffentliche Mittel aufgewendet werden müssen. Dafür danke ich den beteiligten Stiftungen und Institutionen sehr herzlich." Die Förderer sind (in alphabetischer Reihenfolge): Braunschweigische Sparkassenstiftung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Niedersächsische Bingo Umweltstiftung, Niedersächsische Sparkassen Stiftung, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Richard Borek Stiftung. Die Kosten sind auf 454.500 Euro festgesetzt. Davon übernehmen die Sponsoren 230.000 Euro. Der Rest wird aus dem städtischen Haushalt finanziert.
Primäres Ziel der Sanierung ist ein langfristiger Substanzerhalt unter Berücksichtigung des zeitlichen Zeugniswertes des Denkmals. Um die schonendste Variante zur Restaurierung der Zaunanlage herauszufinden, wurde eine Musterrestaurierung an einem Zauntor durchgeführt. An dem Tor wurden verschiedene Reinigungsverfahren, Reparaturtechniken und Farbbeschichtungen untersucht. Diese Maßnahme wurde durch das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege und die Richard Borek Stiftung gefördert. Die gusseisernen Zaunelemente werden demontiert und in einer Werkstatt restauriert. Es erfolgen eine Säuberung durch Feinstrahlung, manuelle mechanische Reinigung und anschließender Korrosionsschutz im bauzeitlichen Farbton. Die originale Verbindungstechnik (Heißvernietung) wird wiederhergestellt.
Sämtliche Türen werden restauriert und wieder funktionsfähig gemacht. Die Türbänder der Toranlage werden überarbeitet, da sie nicht ausreichend dimensioniert sind. Vorhandene und gefundene, gelagerte Elemente werden wieder montiert, abgebrochene nur bei statischer Relevanz ergänzt.

Jana Dietzsch, Dr. Achim Krekeler (Dr. Krekeler Generalplaner GmbH); Svenja Wilters, Dirk Franke, Wolfgang Altmann (städtischer Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement); Miriam Bettin (Kunstverein), Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer, Werner Schilli (Braunschweigische und Niedersächsische Sparkassenstiftung), Wilhelm Eckermann (FB Hochbau und Gebäudemanagement). Foto: Stadt Braunschweig/ Daniela Nielsen
Behutsame Behandlung erforderlich
Besonderes Augenmerk gilt der Anbindung des Gusseisens in den Natursteinbereich, da hier starke Korrosion Schäden im Naturstein verursacht hat. Hier müssen vorhandene Klammern behutsam ausgestemmt und behandelt werden. Fehlende Teile werden aus bauzeitlichem Material nachgefertigt, um einen umlaufenden Ringanker wiederherzustellen. Die Anbindung von Pfeiler und Sockel soll über Führungsstege erfolgen, welche die thermische Dehnung ausgleichen. Schräg stehende Pfeiler, die nicht zu kippen drohen, werden belassen. Der Neigungsgrad wird in regelmäßigen Abständen überwacht. Verschiebungen des Schalenmauerwerks werden mit Verfüllungen von Hohlräumen mit Kalkmörtel minimiert.
Auch bei den Natursteinelementen zählt der Zeugniswert. Hier wird Fehlendes nur ergänzt oder ausgetauscht, um die Substanz zu erhalten und die Stabilität zu erhöhen. Hier wird unter anderem mit Dampfstrahl gereinigt. Risse werden mit Steinersatz verschlossen.
Die Vasen werden mit Heißdampf und einem Mikrofeinstrahlungsgerät gereinigt, Risse mit Injektionsharz bzw. mineralischem Injektionsmörtel verfüllt. Bruchgefährdete Bereiche werden mit Edelstahldübeln gesichert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Oktober beendet werden.
Zur Geschichte der Villa Salve Hospes
Dieses frühklassizistische Stadtpalais ließ sich der Kaufmann Diedrich Wilhelm Krause 1805 bis 1808 auf einem großzügigen Grundstück des neu geschaffenen Wallrings errichten. Architekt war der Leiter des Bauwesens im Herzogtum Braunschweig, Peter Joseph Krahe (*8. April 1758, †7. Oktober 1840), der auch die Anlage des Wallrings auf dem Gelände der aufgelassenen Bastionärsbefestigung geplant und geleitet hatte.
Das große Wohnhaus auf geschosshohem Sockel und die beiden kleineren Wirtschaftsgebäude umschließen einen Ehrenhof. Zum Hauptportal im vorgeschobenen Risalit führt eine dreiläufige Freitreppe mit zwei Greifenpaaren, die gläserne Kandelaber tragen. Über dem Eingang ist die Hausinschrift "Salve Hospes" (Sei gegrüßt, Gast) angebracht. Die klare Proportionierung der Fassaden und das ausgewogene Verhältnis des Grundrisses zum Außenbau machen die Villa zu einem Hauptwerk des deutschen Frühklassizismus. Das Gebäude ist heute Sitz des Kunstvereins. (aus: "BLIK – Braunschweiger Leit- und Informationssystem für Kultur").