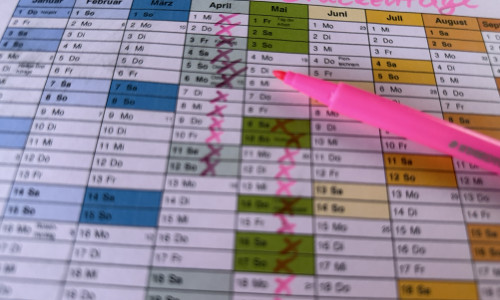Braunschweig. Anfassen ausdrücklich erlaubt: Das Herzog Anton Ulrich-Museum geht neue Wege in der Museumspädagogik. Mit einem sogenannten Multi-Touch-Tisch sollen Kunstwerke den Besuchern näher gebracht werden - näher, größer, mit allen möglichen Informationen versehen. Am Freitag haben Dr. Sven Nommensen, Leiter der Museumspädagogik, und Peter Gerjets von der Universität Tübingen den Tisch vorgestellt.
Wer Wissen vermitteln will, muss vor allem verstehen, wie Wissen in den Köpfen der Menschen ankommt. Daran haben Forscher des Leibniz-Instituts für Wissensmedien an der Universität Tübingen gearbeitet und zusammen mit dem Museum ein neues System erarbeitet, das im bald wieder eröffneten Museum angewandt werden soll. Das Herzstück des Ganzen ist ein Tisch, in den ein riesiger Touch Screen integriert ist. Kunstwerke lassen sich darauf anschauen, vergrößern, Informationen zu verschiedenen Aspekten liegen auf der Rückseite der Bilder, die wie verstreut "auf" dem Tisch umherliegen.
Intuitiv sollen die Museumsbesucher mit dem Gerät umgehen. An einem Prototyp, der zurzeit in der Burg Dankwarderode steht, wurde bereits getestet, ob das Gerät seinen beabsichtigten Zweck erfüllt - auch anhand der Rückmeldungen im Gästebuch kommen Nommensen und Gerjets zu dem Schluss: Es funktioniert. Die animierten Sequenzen, Texte und 3D-Ansichten begeistern alle Altersklassen.
Das Besondere an dem Braunschweiger/Tübinger System: Es liefert nicht nur den museumstypischen Inhalt, sondern schafft den Spagat zwischen Information und Psychologie. Nach aktuellen Erkenntnissen gestaltet, soll es das Interesse der Nutzer wach halten und möglichst viel Information im Hirn verankern. Denn was nützt das schönste Spielzeug, wenn hinterher nicht einmal der Name des Künstlers hängen bleibt?
Auch eine iPad-App gibt es bereits, sie wurde schon rund 800 Mal heruntergeladen, erzählt Gerjets. Darin kann man die Werke der Ausstellung auf einem Zeitstrahl oder wahlweise im Lageplan des Museums ansehen und Zusatzinformationen abrufen. Die Erfahrung zeige, dass die Originale durch diese technischen Erweiterungen aber nicht vernachlässigt würden, sagt Nommensen.
Das einzige wirkliche Problem an der Geschichte sind die Anforderungen, die die Forscher an solche Texte stellen. Die müssen auf eine Art geschrieben sein, dass der Leser gleichzeitig lernt und weiter Lust behält, weiter zu lesen. "Dazu gibt es Workshops", sagt Gerjets, "aber das System ist nur so gut wie die Inhalte, die darin stehen."
Gekostet hat die Entwicklung inklusive Forschung rund 1,3 Millionen Euro; eine knappe Million wurde über Drittmittel finanziert.
Erweiterte Kunstwerke: Herzog Anton Ulrich-Museum stellt neue Technik vor
von Christina Balder