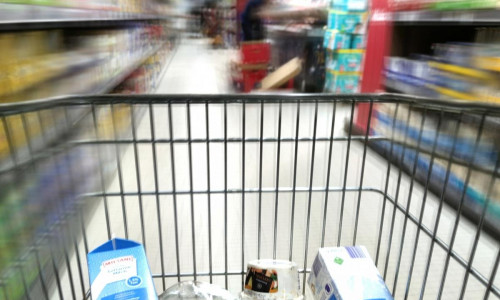Braunschweig. Die Ankunft der vielen Flüchtlinge in den vergangenen Tagen ist aktuell ein zentrales Thema. Ein Wort, das dabei immer wieder fällt, ist der Begriff "Willkommenskultur". Professor Dr. Hannes Schammann, Juniorprofessor für Migrationspolitik an der Universität Hildesheim erklärt, wie es der Begriff in aller Münder geschafft hat.
Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass die Deutschen ihre Tore weit öffnen können – und dies während der größten Massenwanderung, die das Land seit dem Kriegsende gesehen hat. Gewissermaßen eine gelebte Willkommenskultur. Als der Begriff im Jahr 2010 immer häufiger auftauchte, meldeten sich auch allmählich die Parteien. "Die Politiker wollten den Begriff in ihre Parteiprogramme aufnehmen und somit auch ihre Strategien für Zuwanderung", erzählt Professor Dr. Hannes Schammann. Allerdings tauchte damals der Begriff eher im Zusammenhang mit der Fachkräftegewinnung auf und nicht im Kontext mit einer Flüchtlingswelle. Die politische Auslegung der Willkommenskultur sollte also den Fokus auf ausländische Fachkräfte legen. "Man überlegte sich Strategien, wie Deutschland attraktiv für Fachkräfte werden könnte", so Schammann.
Wer war zuerst da?

Professor Dr. Hannes Schammann, Juniorprofessor für Migrationspolitik an der Universität Hildesheim. Foto: Sina Rühland
Während sich die Politik überlegte, wie man den Arbeitsmarkt aufpeppen könnte, erschien ebenfalls im Jahr 2010 Thilo Sarrazins "Deutschland schafft sich ab". Doch was war zuerst da? Sarrazins Thesen oder das Modewort? "Der Begriff 'Willkommenskultur' wurde in die migrationspolitische Debatte vor allem als rhetorisches 'Gegenmittel' zu zu Sarrazins Thesen und vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels eingeführt", so Schammanns Zwischenfazit. Der Begriff habe häufig nur als "trojanisches Pferd" für verschiedene Inhalte gedient. Konsens habe nur darin bestanden, dass er verwendet wurde – nicht aber wie und in welchem Kontext.
Auf den Weg zum praxisnahen Verständnis
Praxisnah ist das, was in vielen Städten Deutschlands heute passiert. Menschen wollen sich einbringen, sie wollen helfen, wo es nur geht. Sie möchten willkommen heißen. "Die Willkommenskultur meint also einerseits eine offene Haltung der Aufnahmegesellschaft gegenüber Neuzuwanderern – hier sind vor allem Akteure der Zivilgesellschaft gefragt. Willkommenskultur erfordert aber auch den Aufbau von Willkommensstrukturen in Kommunen – dabei ist dann vor allem die Verwaltung gefragt", so Schammann.
Tatsächlich willkommen?
Laut einer Umfrage von infratest dimap schämen sich fast neun von zehn Personen für die gewalttätigen Proteste. Außerdem haben sechs (59 Prozent) von zehn Deutschen keine Angst vor "zu vielen" Flüchtlingen. Zudem finden es 95 Prozent gut, dass sich viele Bürger für Flüchtlinge engagieren. Mittlerweile fordert jeder Zweite mehr Schutz vor fremdenfeindlichen Angriffen. Und: mehr als die Hälfte der Befragten will keine Leistungskürzungen für Asylsuchende.