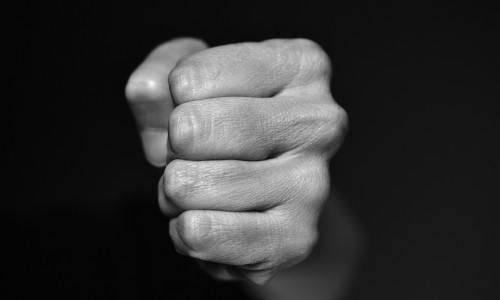Es sind Bilder, die ein ganzes Land geprägt haben: hupende Trabis, die über die Grenzübergänge rollen, jubelnde Menschen, die sich in den Armen liegen, Tränen, die nicht mehr aufhören wollten zu fließen. Als die Mauer im November 1989 fiel, war das für viele wie ein Wunder. Ein Jahr später, am 3. Oktober 1990, wurde die Deutsche Einheit offiziell - ein historischer Glücksfall, den kaum jemand für möglich gehalten hatte.
Heute, 35 Jahre danach, ist von der Euphorie geblieben, was Geschichte immer hinterlässt: Erinnerung, Stolz, aber auch Zweifel. Die Deutsche Einheit ist längst Alltag geworden. Doch der Feiertag wirft Fragen auf: Was wurde seither erreicht? Wo liegen die Bruchlinien bis heute? Und wie hat sich der Blick auf diesen Tag in den letzten Jahrzehnten verändert?
Hoffnung und Verantwortung
Für Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies ist die Einheit mehr als ein Kapitel im Geschichtsbuch. Sie ist persönliches Erlebnis und politischer Auftrag zugleich. „Der Tag der Deutschen Einheit ist auch für mich persönlich immer ein besonderer Tag – in diesem Jahr feiern wir bereits 35 Jahre Deutsche Einheit. Ein Glücksfall in unserer Geschichte, der Freiheit und Demokratie für alle Deutschen brachte“, so der Ministerpräsident gegenüber regionalHeute.de
Er erinnert sich an die „unbändige Freude“ jener Monate nach dem Mauerfall, an die Hoffnungen, die Millionen Menschen verbanden. Doch für Lies darf es dabei nicht bleiben. „Der Tag der Deutschen Einheit steht nicht nur für die Freude über die Wiedervereinigung, sondern auch dafür, dafür zu sorgen, dass wir in Deutschland, in allen Bundesländern im Osten und im Westen, gleiche Chancen, Möglichkeiten und Lebensperspektiven haben.“
Lies’ Worte treffen einen Nerv. Denn während das Trennende in den letzten Jahren oft lauter erscheint als das Gemeinsame, bleibt der 3. Oktober für ihn ein Signal: „In Zeiten, in denen man häufig den Eindruck gewinnen kann, dass Trennung und Spaltung viel stärker wahrgenommen werden als das Gemeinsame, ist der Tag der Deutschen Einheit auch ein Signal dafür, wieder gemeinsam an Zielen zu arbeiten und für Freiheit und Demokratie zusammenzustehen!“
Euphorie an der Grenze
Wie sehr der Umbruch auch in Niedersachsen und der Region Braunschweig zu spüren war, weiß Dr. Thomas Kubetzky vom Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte an der Technischen Universität Braunschweig. „Die Euphorie über das Verschwinden der Grenze war allgemein zu spüren, teilweise wurden nun Jahrzehnte unterbrochene Verbindungen in die Nachbarregionen wieder aufgenommen bzw. neu geknüpft.“
Plötzlich lag Braunschweig nicht mehr am Rand der Bundesrepublik, sondern in deren Mitte. Wege, die über Jahrzehnte verschlossen waren, öffneten sich. Familien, die getrennt lebten, konnten wieder zueinanderfinden. Für viele war das Gefühl, nicht mehr am Ende Europas zu stehen, sondern im Herzen, ein Aufbruch, der kaum in Worte zu fassen war.
Erfolge und Brüche
Seitdem hat sich viel getan. Milliarden flossen in den Aufbau Ost, Straßen, Schulen, Städte wurden modernisiert. Unternehmen siedelten sich an, ganze Regionen erfuhren einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Arbeitslosigkeit, die in den 1990er Jahren für viele Ostdeutsche Alltag war, ist heute deutlich gesunken. Eine Generation, die nach 1990 geboren wurde, kennt die Mauer nur noch aus Erzählungen oder dem Geschichtsunterricht.
Und doch bleibt die Bilanz zwiespältig. „Auch nach 35 Jahren wirken die unterschiedlichen Biographien vor und nach 1989 nach. Inzwischen wird gar von einer zunehmenden Entfremdung gesprochen“, sagt Kubetzky. Die Unterschiede in Löhnen und Renten sind noch immer spürbar, viele junge Menschen verlassen ostdeutsche Regionen, die politische Kultur unterscheidet sich mancherorts deutlich von der im Westen. Das zeigt sich nicht zuletzt in den Wahlergebnissen, die immer wieder das Gefühl von „zwei Realitäten“ in einem Land aufscheinen lassen.
Vom Feiertag zum freien Tag
Nicht nur die Bilanz der Einheit selbst hat sich verändert, auch der Blick auf den 3. Oktober. In den ersten Jahren war es ein Tag der Euphorie, ein Symbol für das Wunder der Wiedervereinigung. Heute, sagt Kubetzky, sei das anders: „Vermutlich wird man konstatieren müssen, dass dieser Tag für die meisten Menschen ein willkommener freier Tag ist, der, wie in diesem Jahr, zu einem verlängerten Wochenende einlädt.“
Immer weniger Menschen wissen noch aus eigener Erfahrung, was es bedeutete, in der DDR zu leben, den Transit nach Westberlin zu fahren oder am Schlagbaum von Grenzbeamten kontrolliert zu werden. „Immer weniger Menschen haben die DDR, die alten BRD und die Teilung noch selbst erlebt“, sagt Kubetzky und verweist auf die Gefahr einer „verklärenden Sicht auf die Vergangenheit“.
Mehr als Erinnerung
35 Jahre nach der Wiedervereinigung ist der 3. Oktober beides: Anlass zum Feiern – und Anlass zur Selbstprüfung. Deutschland ist zusammengewachsen, aber nicht in allen Bereichen wirklich eins geworden. Einheit ist kein abgeschlossener Akt, sondern ein Prozess, der weitergeht.
„Diejenigen, die für die Wiedervereinigung gestritten und für Freiheit und Demokratie gekämpft haben, haben ein großes gemeinsames Ziel erreicht“, sagt Olaf Lies. Doch dieses Ziel bleibt Auftrag. Denn Einheit bedeutet, Unterschiede anzuerkennen, ohne sie zur Spaltung werden zu lassen.
Der 3. Oktober 2025 ist deshalb mehr als ein historisches Jubiläum. Er ist ein Tag, der zeigt, wie weit Deutschland gekommen ist und wie weit der Weg noch ist. Ein Tag, der uns feiern lässt, ohne die offenen Aufgaben zu übersehen. Und ein Tag, der daran erinnert, dass Freiheit, Zusammenhalt und Demokratie niemals selbstverständlich sind.