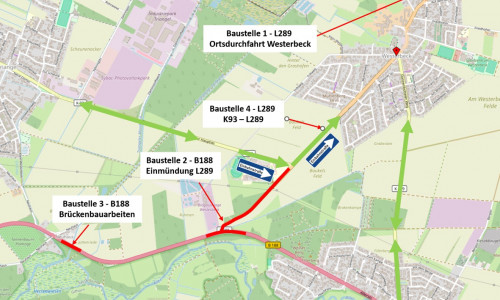Braunschweig. Bunt, ereignisreich und eine sehr vielseitige Musikszene: Das war unsere Stadt in den 80er Jahren. Viele erinnern sich gerne zurück an die Zeit zwischen „Bohlweg-Pizza-Mauer“ und „Löwenhertz-Rockwettbewerbe im FBZ“.
Der Erfolg der Facebook-Seite „Bohlweg-Zeiten - Die 80er in Braunschweig“ spricht für sich. (Das Interview mit Ole Schulz-Weber, dem Gründer der Gruppe, lesen sie hier.)
Wir haben Braunschweigs Ersten Stadtrat, Ulrich Markurth, getroffen. Als Dezernent für Soziales, Gesundheit und Jugend wollten wir von ihm wissen, wie er diese Zeit in Braunschweig erlebt hat. Markurth (Jahrgang '56) hat die 80er in einer sehr guten, fröhlichen Erinnerung. Zum BraunschweigHeute.de-Interview brachte er sogar einige Fotos aus dem Privat-Archiv mit:
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an die 80er in Braunschweig denken?
Markurth: Ich denke zunächst an mich, wie es mir ging?! Vielleicht war es die spannendste Phase auch meines Lebens, nach der Jugendphase und vor der Familienphase. Ich war noch im Studium und es war ein bisschen wie Leben im Experiment. Man konnte viele Dinge ausprobieren und ich habe viele ausprobiert. Das war in Braunschweig möglich. Es hat sich einiges entwickelt, auch schon in den 60ern und 70ern. Es kam langsam Bewegung hinein und am Ende war ganz Deutschland durch die Wiedervereinigung bewegt. Die war allerdings am Anfang in Braunschweig weder denkbar, noch spürbar. Die Baulücken fielen weg. Es gab erste Straßen-Cafés, die es vorher so nicht gab. Es gab ein paar spannende Discotheken und speziell für uns eine große Kneipenszene, die wir unheimlich mochten. Sowohl Breite Straße / Handelsweg, als auch im Uni-Viertel. Und da spielte sich eigentlich unser Leben ab.
Welche Orte der 80er fallen ihnen noch ein?
Markurth: Das war ja bei mir das Ende Studienzeit. Ich habe versucht, das noch ein bisschen zu verlängern durch Jobs und Halbtagsbeschäftigungen, weil man ja doch an seiner Freiheit hing, die ganz schön war. Und da gibt es ganz bestimmte Orte. Ich habe in der Zeit Kabarett gespielt, bis Mitte der 80er. Der „Lindenhof“ war eine Location, in der wir hier in Braunschweig aufgetreten sind. Das hat unheimlich Spaß gemacht, da etwas auszuprobieren, sich selbst auszuprobieren. Es gab kleine Theater am Madamenweg, klitzeklein, die kennt man heute gar nicht mehr. Das waren sehr spezielle Orte. Wenn wir Klassentreffen hatten, sind wir im „Knuff“ gelandet. Das gibt es seit vielen Jahren nicht mehr. Das war ein Stückchen Heimat. Einige Dinge vermisse ich, bei ein paar anderen Dingen bin ich ganz froh, dass es sie nicht mehr gibt.
Wie muss ich mir Ulrich Markurth in den 80er Jahren vorstellen?
Markurth: Noch sehr experimentierfreudig. Ich habe schon gespürt, dass das die Zeit ist, in der Weichen gestellt werden. Und wenn du noch einmal etwas ausprobieren willst, bevor du beruflich gesettet bist, also vor der Familienphase, dann musst du es jetzt machen. Ich habe immer wieder Freunde gefunden, mit denen das auch ging. Ich hatte einen Halbtagsjob als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Bundestag, war also auch viel unterwegs. War gleichzeitig Landestrainer für Kanu-Slalom und Wildwasser, war in ganz Europa auf Tour. Das ging nur in dieser Kombination. Ich hatte mir auch vorstellen können, Bundestrainer zu werden. Es ist ja eine Olympische Disziplin - oder eben Kabarett. Politisches Kabarett habe ich bis ungefähr 1985 gemacht. Wir waren, in aller Bescheidenheit, recht erfolgreich auch in ganz Deutschland unterwegs. Also, auch das war eine Option. Es gab ehrlich die Überlegung, was reizt mich am meisten? Das hätte auch ganz anders kommen können, dann wäre ich heute beim Satiregipfel.
In Braunschweig spielen die 80er offenbar eine große Rolle. Ist das ein typisch Braunschweiger Phänomen oder gibt es etwas, was diese Generation bundesweit eint?
Markurth: Ich glaube, es gilt bundesweit. Allerdings hat es für Braunschweig eine besondere Ausprägung gehabt. Das war die Verabschiedung vom „Zonenrandgebiet“. Und uns hat kulturell hier eine ganze Menge erreicht, was anderswo schon war. Es war eine Zeit, wo auch Musik gespielt wurde, die fröhlich machte. Es ging weg von der esoterischen, in sich gekehrten und manchmal Weltschmerz aufgreifenden Szene. Die Neue Deutsche Welle ist so ein Thema gewesen. Sicher musikalisch nicht immer hochwertig, aber wo man einfach Spaß haben konnte. Und das Zweite war, dass super Rockmusik gespielt wurde. Die Punkmusik kam in ihrer deutschen Ausprägung bis zu den Toten Hosen, aber auch Police und so etwas. Das war tanzbar. Wir hatten wieder Musik, die nicht Disco der 70er war. Das war übrigens auch überhaupt nicht meine Welt und der Hardrock der 70er ließ sich kaum tanzen, also tanzte man insgesamt weniger. In den 80ern ging das wieder wunderbar zu Police oder Ska. Das war Lebensfreude. Bei mir weckt das Erinnerungen an ganz viel Lebensfreude. Die mag es woanders auch gegeben haben, aber in Braunschweig habe ich so ein richtiges Aufwachen gespürt und deshalb machte es auch Spaß. Für mich war das übrigens ein Grund, nach Braunschweig zurückzukommen.
Warum gibt es eine Bohlweg-80er-Community und keine 70er oder Bohlweg-90er Jahre?
Markurth: Vielleicht gibt es die 90er auch irgendwann einmal?! Das ist ja ein Generationen- und Identifikationsthema. In den 70ern gab es natürlich auch etwas und ebenso in den 60ern. Gerade der Bohlweg - „Coletti“ – natürlich war da was. Es gab auch eine entsprechende Jugendszene. Wir selbst waren damals schon an anderen Orten. Aber es war etwas düsterer und anders belegt und ich denke, dass das nicht so die freudigen Erinnerungen sind, die man so hat. Obwohl ich über die 70er auch ganz viel sagen könnte. Das war ja meine klassische Jugendzeit von Konfirmation, Tanzstunde, Abitur bis zum Beginn des Studiums. Also auch da war was los. Ich würde sie aber anders belegen. Die 80er sind in meinem Rückblick mit mehr Lebensfreude belegt und das geht vielen meiner Generation genauso. Es war noch eine Chance: Man war schon erwachsen, trotzdem wollte man auch noch einmal etwas ausprobieren, was das Leben mit einem so anstellen kann. Musik spielte nach wie vor eine große Rolle und war in einer Ausprägung, dass man sich auch gerne erinnert. Ich höre aus der Neue Deutsche Welle zwar nicht mehr alles, aber grundsätzlich sehr gerne die Musik der 80er Jahre. Sie wird ja auch viel im Radio gespielt.
In Braunschweig wird aktuell intensiv über das FBZ diskutiert. Zum Teil schwingt da auch eine ganze Menge Nostalgie mit. Kann das auch eine Hemmschuh für künftige Projekte sein?
Markurth: Bei aller Nostalgie, ich habe auch meine Erinnerungen an das FBZ, bis hin zum Folk-Keller. In der Tat kann das hinderlich sein. Man klebt an alten Erinnerungen und versucht diese zu transformieren ins Heute. Aber das wird nicht gelingen. Man muss so etwas wie das FBZ neu denken. Was brauchen wir heute. Was brauchen die Generationen, die sich heute kulturell ausleben wollen. Die nicht nur konsumieren wollen, sondern aktiv etwas machen wollen. Was brauchen die eigentlich? Und diese Fragen dürfen wir nicht mit den alten Antworten belegen. Da muss es viel Raum geben für neue Antworten, für neue Kreativität. Und das Label „FBZ“ ist schon ein bisschen verräterisch, weil es verbrannt ist. Ich will es mal so sagen. Ich war damals gegen den Abriss, aber als es abgerissen wurde, war es eigentlich schon tot. Es war nur noch eine Hülle. Es fand nicht mehr das statt, was wir damals erlebt haben. Das mag man bedauern oder nicht. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir - die Jüngeren und die Älteren - gemeinsam etwas neues schaffen, das auch neue Chancen gibt. Und das wird nicht das alte FBZ sein.