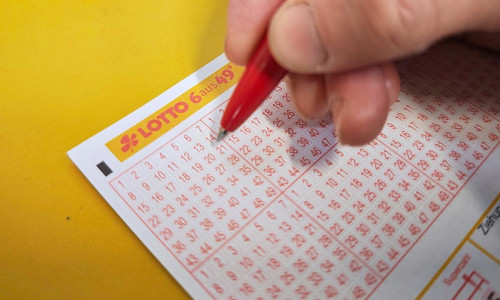Region. Ein Social-Media-Verbot für alle unter 16 Jahren soll Mobbing, sexuelle Belästigung und Manipulation eindämmen. In Wahrheit aber droht es, genau jene auszuschließen, die Schutz und Aufklärung am dringendsten brauchen. Kann man junge Menschen wirklich vor der digitalen Welt bewahren – oder schließt man sie mit solchen Ideen nur aus ihr aus?
Für Millionen junger Menschen sind soziale Netzwerke längst kein Zeitvertreib, sondern Lebenswelt. Sie sind Bühne, Nachrichtenkanal und Gesprächsraum, manchmal Rückzugsort, manchmal Kampfzone. Wer dazugehören will, braucht kein Ausweisverfahren, sondern ein Profil.
Leben zwischen Likes und Lernkurve
„Ich halte ein generelles Verbot sozialer Netzwerke unter 16 Jahren aus medienpädagogischer Sicht für problematisch“, sagt Stefan Schaper, Medienkoordinator für die Stadt Braunschweig beim AWO-Kreisverband Braunschweig e. V. auf Anfrage von regionalHeute.de. Solche pauschalen Einschränkungen griffen zu kurz und verfehlten die Lebenswirklichkeit junger Menschen. „Statt Verbote auszusprechen, sollte der Fokus darauf liegen, Kinder und Jugendliche frühzeitig zu befähigen, mit digitalen Medien verantwortungsvoll umzugehen. Medienbildung von Anfang an ist aus meiner Sicht der bessere Weg, um junge Menschen zu schützen und gleichzeitig ihre Teilhabe zu fördern.“
Denn soziale Medien sind längst ein Ort der Identitätssuche und der Teilhabe. „Dort kommunizieren sie, tauschen sich aus, entdecken neue Interessen und entwickeln ihre Identität“, sagt Schaper. „Außerdem bieten soziale Plattformen wichtige Räume für gesellschaftliche und politische Teilhabe, viele Jugendliche informieren sich dort, beteiligen sich an Diskussionen oder engagieren sich für Themen, die ihnen wichtig sind.“ Ein Verbot würde genau das kappen: den Zugang zu Öffentlichkeit, zu Ausdruck, zu Gemeinschaft.
Bevormundung statt Befähigung
Was als Schutz gedacht ist, gerät zur Entmündigung. „Eine starre Altersgrenze würde die mediale Selbstständigkeit von Jugendlichen deutlich einschränken. Statt sie zu befähigen, würde man sie bevormunden“, warnt Schaper. Besonders fatal: Ein solches Gesetz könnte die soziale Spaltung sogar verschärfen. „Ich denke, dass ein solches Verbot die digitale Kluft eher vergrößern würde - Kinder aus privilegierten Familien würden Wege finden, sich trotzdem online zu bewegen, während andere ausgeschlossen bleiben.“
Kinder, die keine digitale Erfahrung machen dürfen, lernen auch nicht, sich zu schützen. „Kinder lernen nur, mit Risiken umzugehen, wenn sie begleitet und schrittweise Erfahrungen machen dürfen. Verbote verhindern diese Lernprozesse und nehmen ihnen die Chance, Medienkompetenz aufzubauen.“ Ein gesetzliches „Offline-Muss“ würde also genau das verhindern, was Politik vorgibt zu fördern: Mündigkeit.
Technisch kaum umsetzbar
Selbst wenn man wollte, wie ließe sich ein Social-Media-Verbot ab 16 überhaupt kontrollieren? Altersangaben sind schnell gefälscht, Geburtsdaten leicht erfunden. Und jede technische Lösung birgt ein neues Risiko: den Verlust von Datenschutz. „Ehrlich gesagt: nein. Die technische Kontrolle wäre kaum machbar“, sagt Schaper. „Altersangaben in sozialen Netzwerken lassen sich leicht umgehen, und eine wirklich sichere Altersprüfung würde tiefe Eingriffe in den Datenschutz bedeuten.“
Die naheliegendere Lösung, findet er, wäre eine andere: Verantwortung statt Verbote. „Es wäre sinnvoller, dafür zu sorgen, dass sie kindgerechte Standards einhalten, Altersgrenzen tatsächlich beachten und ihre Inhalte transparent gestalten. Aktuell laufen im Rahmen der Europäischen Union entsprechende Versuche, unter anderem in Dänemark.“
Die Realität: Jugendliche sind technisch erfahrener als viele ihrer Eltern. Wer ihnen Zugänge verwehrt, lehrt sie nur, neue Wege zu finden.
Jugendschutz und Datenschutzprobleme
Während Politiker über neue Altersgrenzen nachdenken, sehen Datenschützer ein ganz anderes Risiko: dass Jugendschutz zum Einfallstor für Datensammelei wird. „Die Datenschutzaufsichtsbehörden sehen ein erhebliches Problem bei der Datenschutzkonformität vieler Altersverifikationssysteme, da in vielen Fällen der Grundsatz der Datenminimierung nicht ausreichend berücksichtigt wird“, sagt Achim Barczok, Pressesprecher beim Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen, gegenüber regionalHeute.de.
Oft würden für die Altersprüfung Informationen verarbeitet, die mit dem Alter selbst nichts zu tun haben. „Wird beispielsweise der Personalausweis für die Altersverifikation genutzt, werden einige auf dem Ausweis vorhandene Informationen wie Anschrift, Größe, Augenfarbe und Ausweisnummer nicht benötigt. Dennoch wird oft ein Foto vom Ausweis erbeten.“
Dabei sei die Sache einfach, so Barczok: „Zur Altersverifikation ist jedoch lediglich die Information notwendig, ob die Person das erforderliche Alter bereits erreicht hat oder nicht.“ Was nach Kontrolle aussieht, schafft also neue Überwachung.
Europas digitale Hoffnung
Einen Ausweg sieht Barczok in einem europäischen Zukunftsprojekt, der European Digital Identity Wallet (EUDI-Wallet). Sie soll bis Ende 2026 allen EU-Bürgerinnen und -Bürgern zur Verfügung stehen. „Bei entsprechender Ausgestaltung könnte diese beispielsweise bei einer Altersverifikation an die Betreiber von sozialen Netzwerken ausschließlich die Information übermitteln, ob der Besitzer des Wallets das erforderliche Mindestalter erreicht hat – oder nicht.“
Eine elegante Lösung: datensparsam, sicher, theoretisch. Noch ist sie Zukunftsmusik. Bis dahin bleibt die Kontrolle eine Illusion.
Zwischen Regulierung und Realität
Politisch bewertet die Datenschutzbehörde den Vorschlag nicht, doch Barczok macht klar: „Es besteht kein Zweifel, dass der Jugendschutz auf Social-Media-Plattformen in der aktuellen Form defizitär ist. Für eine hohe Wirksamkeit des Jugendschutzes ist aus unserer Sicht vor allem eine zuverlässige Altersverifikation und eine konsequente Rechtsdurchsetzung gegenüber internationalen Plattformbetreibern notwendig – das gilt für die aktuellen Regulierungsinstrumente ebenso wie für mögliche weitreichendere Altersbeschränkungen.“
Schaper hingegen fordert: Bildung statt Bevormundung. „Kinder und Jugendliche brauchen von klein auf Unterstützung, um digitale Kompetenzen zu entwickeln, angefangen in der Kita über die Schule bis hin zur Ausbildung. Medienpädagogik sollte fester Bestandteil aller Bildungsphasen sein, und pädagogische Fachkräfte müssen entsprechend geschult werden.“
Gleichzeitig müsse die Politik die Anbieter stärker in die Pflicht nehmen, sagt Schaper. „Es braucht also einen ganzheitlichen Ansatz, mit klarer Regulierung, aber vor allem mit einer starken, lebensweltbezogenen Medienbildung.“
Zwischen Symbolpolitik und Wirklichkeit
Ein Social-Media-Verbot für alle unter 16 klingt entschlossen, tatsächlich offenbart es vor allem die Ratlosigkeit einer Politik, die den digitalen Alltag nicht versteht. Die Jugendlichen leben längst dort, wo man sie zu schützen glaubt: im Netz.
Zwischen Symbolpolitik und Realität bleibt nur die Erkenntnis: Wer Kinder schützen will, muss sie begleiten, nicht aussperren. Der wirksamste Jugendschutz beginnt nicht mit einem Klick auf „Verbot“, sondern mit Aufklärung, Vertrauen und Verantwortung – in Klassenzimmern, an Küchentischen, in der digitalen Wirklichkeit. Denn wer jungen Menschen das Internet verbieten will, zeigt vor allem, dass er ihre Welt längst verloren hat.