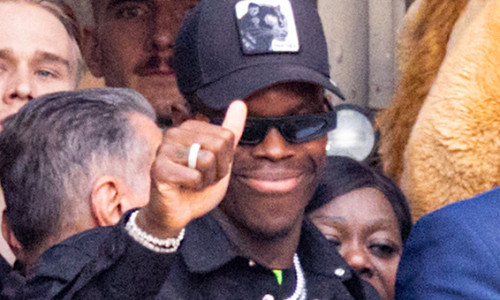Wolfenbüttel. Auf den Feldern im Landkreis Wolfenbüttel wird es wieder wuselig - der Landkreis fördert im Rahmen des „Niedersächsischen Weges“ Blühflächen, hamsterfreundliche Bewirtschaftung und extensives Grünland, wo sich Feldhamster und Rebhühner wieder vermehrt ansiedeln und ausreichend Nahrung finden. So heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreis Wolfenbüttel.
Davon konnte sich Mitte August Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte bei einem Rebhuhnprojekt vor Ort überzeugen. In Wolfenbüttel-Leinde traf sie sich mit Landrätin Christiana Steinbrügge, Mitarbeitern des Umweltamtes sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Landwirtschaft und Naturschutz. Treffpunkt war ein Acker von Landwirt Matthias Johns in der Nähe des Oderwaldes.
Idealer Lebensraum für Rebhühner
Die fünf Hektar große Blühfläche bietet im Verbund mit den angrenzenden Brachflächen einen idealen Lebensraum für Rebhühner, die sich bereits nach knapp einem Jahr auf der Fläche bei Leinde angesiedelt haben. Derzeit werden im gesamten Landkreis Wolfenbüttel 104 Hektar als Rebhuhnlebensraum und weitere 364 Hektar als Feldhamsterlebensraum aktiv durch die Untere Naturschuttbehörde gefördert. Hinzu kommen 32 Hektar Grünland, die Bodenbrütern wie der Feldlerche Schutz bieten. Neben der Anlage von Hecken dienen diese Maßnahmen der Umsetzung des Niedersächsischen Weges, einer Kooperation zwischen Landwirtschaft und Naturschutz aus dem Jahr 2020.

Landrätin Christiana Steinbrügge (li.) während der Vorstellung einer Fläche speziell für den Rebhuhnschutz nahe Leinde. Foto: Wolfgang Ehrecke / LWK
Durch den Strukturwandel in der Agrarlandschaft sind die Bestände von Rebhuhn und Feldhamster seit den 1950er Jahren massiv eingebrochen. Bejagung und Weiterentwicklungen der Erntetechnik führten schließlich fast zum Verschwinden der Arten. Das umfangreiche Maßnahmenpaket des Landkreises zielt darauf ab, die Bestände dieser sogenannten Leitarten zu stützen und die Vernetzung ihrer Lebensräume zu verbessern. Als Leitarten für eine artenreiche, vom Menschen geprägte Agrarlandschaft stehen Rebhuhn und Feldhamster stellvertretend für alle anderen hier vorkommenden Tier- und Pflanzenarten. Die im Rahmen der Programme umgesetzten Maßnahmen fördern somit gleichzeitig viele weitere seltene Insekten, Vögel und Pflanzen.
Für den Artenschutz hat der Landkreis Wolfenbüttel im Jahr 2024 rund 400.000 Euro Fördermittel aus kreiseigenen Mitteln und Ersatzgeldern zur Verfügung gestellt. Diese Gelder gehen insbesondere an Landwirte, um sie für den Mehraufwand bei der Pflege oder den Ernteverzicht auf Naturschutzflächen zu entschädigen. Durch die derzeitige undurchsichtige Situation der Agrarumweltförderung aus EU-Mitteln und den Wegfall der bis dahin vorgeschriebenen Flächenstilllegung (4-Prozent-Regelung) fielen in 2023 sehr viele Flächen aus der bisherigen Förderung heraus.
Für die Landwirtschaft unattraktiv
Wenig attraktive Förderung auf den ertragreichen Standorten, zunehmende Unsicherheit und strenge Kontrollen machen die sogenannten AUKM-Maßnahmen für die Landwirtschaft unattraktiv. Aus diesem Grund sind die Ausgaben des Landkreises für den Naturschutz seit 2023 stark angestiegen. Ein Teil der sonst wegfallenden Stilllegungsflächen konnte so durch die Landkreisprogramme übernommen werden, um die für den Naturschutz wichtigen Flächen zu sichern. Dies ist jedoch nur möglich, solange auch Ersatzgelder, etwa aus dem Ausbau der Windenergie, vorhanden sind. Es ist daher dringend erforderlich, dass auch die Förderung über Agrarumweltmaßnahmen wieder an Attraktivität gewinnt, um die Flächen wieder in die Landesförderung überführen zu können, wie es der niedersächsische Weg vorsieht.
Der Landkreis Wolfenbüttel ist zusammen mit dem Landkreis Peine eine von derzeit neun Pilotregionen für die erweiterte Biotop- und Artenschutzberatung in Niedersachsen. Ziel ist es, die Arten- und Biotopvielfalt sowie die Biodiversität in der strukturarmen, intensiv genutzten Agrarlandschaft zu verbessern.
Rebhuhnschutz ist Vorzeigeprojekt
Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte: „Das Projekt zeigt, wie viel wir für den Naturschutz in der Landwirtschaft bewegen können, wenn alle an einem Strang ziehen. Für den Rebhuhnschutz setzen sich hier nicht nur der NABU und die Landwirtschaftskammer als Partner des Niedersächsischen Weges sowie Landwirt Matthias Johns ein, sondern auch der Landkreis – das hat Vorbildcharakter.“
Wolfenbüttel macht blau
Landrätin Christiana Steinbrügge und Umweltdezernent Sven Volkers nutzten die Gelegenheit, der Landwirtschaftsministerin auch die Landkreisstrategie „Blueing“ beziehungsweise „Wolfenbüttel macht blau“ vorzustellen und das Strategiepapier zu überreichen. Blueing bezeichnet eine wasserbasierte und ökosystemverstärkende Veränderung der Landnutzung. Das Konzept fußt auf der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, dass Wasser der primäre Stoff aller lebensentfaltenden und -erhaltenden Prozesse ist und dass wasserhaltende Landschaften und Landnutzungen viele wesentliche Ökosystemleistungen gleichzeitig erbringen können.
Neben der Etablierung von Agroforst und weitere Landnutzungsmodule im Offenland, wie etwa die Anlage von Heckenstrukturen, die Wiedervernässung des Großen Bruchs sowie Humusaufbau, soll das Blueing auch auf andere Flächennutzungen wie die Forstwirtschaft und die Siedlungsflächen ausgedehnt werden. Dies alles mit dem Ziel, Wolfenbüttel möglichst großflächig „blau“ zu machen, um auch die Oberflächentemperaturen in den Sommermonaten zu verringern.