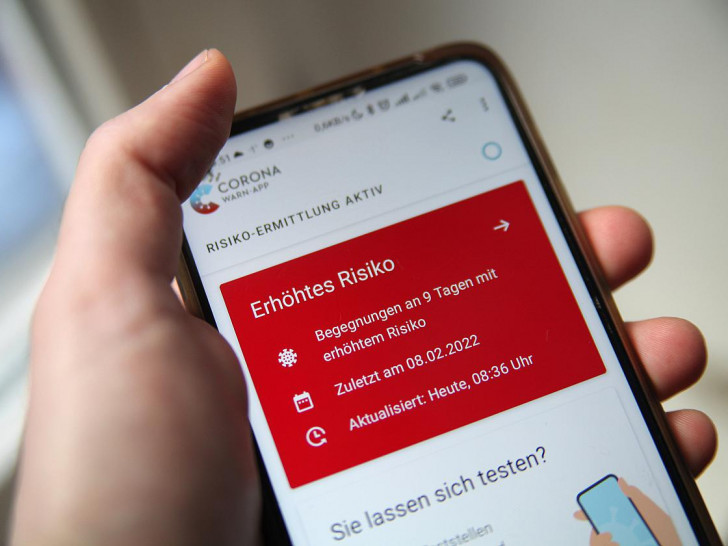Berlin. Mehr als 530.000 Arbeitnehmer haben ihre Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland mittlerweile als Arbeitsunfall oder Berufskrankheit gemeldet, doch häufig wird die Anerkennung als solche abgelehnt. Unabhängige Beratungsstellen plädieren nun für eine erleichterte Anerkennung, wie die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Freitagsausgabe berichtet.
Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Zahl der gemeldeten Berufskrankheiten in Deutschland zuletzt massiv gestiegen ist. Gut fünfmal so viele Menschen wie in einem typischen Halbjahr vor der Pandemie haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres eine Berufskrankheit angezeigt. Das geht aus aktuellen Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung hervor, dem Dachverband der Unfallversicherungsträger. Für die Betroffenen geht es bei einer Anerkennung um eine bessere medizinische Versorgung und womöglich eine Rente, zum Beispiel im Fall von "Long Covid", oder wenn Menschen nur noch eingeschränkt arbeitsfähig sind.
Für die Unfallversicherungsträger geht es jedes Jahr um mehr als zehn Milliarden Euro. Viele der Anzeigen kommen von Pflegekräften, Ärzten oder Erziehern. Sie müssen weniger Beweise bringen, damit ihre Infektion als Berufskrankheit anerkannt wird - weil davon ausgegangen wird, dass sie auf der Arbeit häufig mit dem Virus in Kontakt kommen. Dementsprechend sind etwa 70 Prozent dieser Anträge bereits positiv beschieden.
Schwieriger ist es für all jene, die in anderen Berufen arbeiten, aber davon ausgehen, sich ihre Infektion auf der Arbeit geholt zu haben. Betroffene müssen hier konkret belegen, wer sie angesteckt hat. Von diesen Anzeigen sind dementsprechend bisher erst etwa ein Drittel anerkannt worden. Das kritisieren die drei unabhängigen Beratungsstellen für Berufskrankheiten in Deutschland, finanziert von den Landesregierungen in Bremen, Hamburg und Berlin.
Die drei Beratungsstellen haben sich mit einem internen Brandbrief an das Bundesarbeitsministerium gewandt. In diesem Brief, über den die "Süddeutschen Zeitung", NDR und WDR berichten, kritisieren sie, dass die Ermittlungen oft zu ungenau seien und dass es keine klaren Regeln für die Ermittler gebe. Die Berliner Arbeitssenatorin Katja Kipping (Linke), deren Haus die Berliner Beratungsstelle finanziert, hat im vergangenen Sommer an das Bundesarbeitsministerium geschrieben. In ihrem Schreiben forderte sie eine konkrete Änderung des Sozialgesetzbuchs VII. Die Anerkennung als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall dürfe "nicht abgelehnt werden, nur, weil Beweismittel, die die Arbeitgebenden in zumutbarer Weise erheben bzw. zur Verfügung stellen können, nicht ermittelt werden", so Senatorin Kipping.
Auch die Berichterstatterin für Arbeitnehmerrechte für die Grünen im Bundestag, Beate Müller-Gemmeke, fordert "ein Mindestmaß an Unterlagen, die gesichtet werden müssen". Nur so könne man den betroffenen Beschäftigten wirklich gerecht werden. Das Bundesarbeitsministerium lehnt die vorgeschlagenen Änderungen in einer Antwort an Kipping ab, wie die Süddeutscher Zeitung berichtet. Nur weil ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter nicht ausreichend schütze, etwa vor einer Corona-Infektion, dürfe dies nicht die Chancen auf eine Anerkennung als Berufskrankheit erhöhen.
Würden die Forderungen umgesetzt, müssten praktisch alle Anzeigen anerkannt werden, schreibt das Ministerium. Auf Anfrage von SZ, NDR und WDR will das Ministerium die Berliner Forderungen nicht weiter kommentieren und verweist auf eine "umfangreiche Weiterentwicklung" des Berufskrankheitenrechts aus dem Jahr 2020.
Beratungsstellen für leichte Anerkennung von Arbeitsunfall Corona
Mehr als 530.000 Arbeitnehmer haben ihre Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland mittlerweile als Arbeitsunfall oder Berufskrankheit gemeldet, doch häufig wird die Anerkennung als solche abgelehnt.
Symbolbild. | Foto: Über dts Nachrichtenagentur