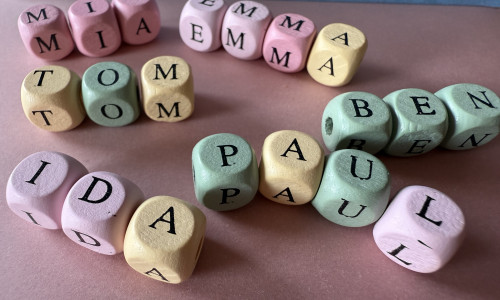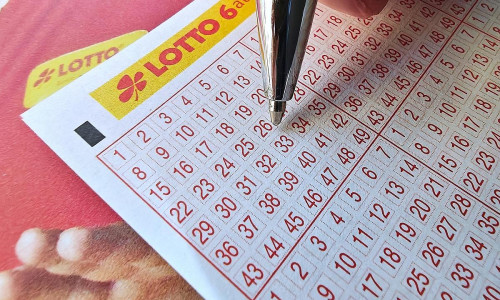Braunschweig. Das Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen hat den Erreger der Syphilis in seine Sammlung aufgenommen und stellt ihn Forschern in aller Welt für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung. Bisher konnte das Bakterium Treponema pallidum subsp. pallidum nur in Labortieren, insbesondere Kaninchen, vermehrt werden. Forscher aus den USA haben eine Methode entwickelt, die die Vermehrung des Krankheitserregers in der Zellkultur ermöglicht. Die DSMZ ist eine der zwei Bioressourcen-Sammlungen weltweit, an der die so erzeugten Bakterien hinterlegt sind. Das berichtet die DSMZ in einer Pressemitteilung.
Die Vermehrung des Syphilis-Erregers war seit seiner Isolierung im Jahr 1912 nur in Labortieren möglich. Bereits im Jahr 2021 publizierte das Team um Prof. Dr. Steven J. Norris an der Universität Texas, USA, die Anleitung zur in vitro-Kultivierung des Bakteriums. „Die Bakterien werden zusammen mit Hautzellen des Baumwollschwanzkaninchen gezüchtet. Diese Vorgehensweise vermeidet den Einsatz von Labortieren“, erklärt Mikrobiologin Dr. Sabine Gronow, Leiterin der Arbeitsgruppe Pathogene Bakterien am Leibniz-Institut DSMZ.
„Die Anzucht von Treponema pallidum in der Petrischale ist aber extrem kompliziert. Aktuell etablieren wir an der DSMZ das von der Gruppe um Professor Norris entwickelte Protokoll.“ Bis die DSMZ selbst das Bakterium vermehren kann, stellt die Arbeitsgruppe von Prof. Norris die Bioressource der DSMZ zur Weitergabe an Forscher zur Verfügung. Das Team rund um Sabine Gronow stellt den Forschern zusätzlich auch isolierte DNA des Bakteriums zur Verfügung. Das ermöglicht den Einsatz in Diagnostik und Forschung ohne eine aufwändige Kultivierung des Bakteriums.
Der Erreger der Syphilis
Das spiralförmige Bakterium T. pallidum subsp. pallidum ist seit über 100 Jahren als Erreger der Geschlechtskrankheit Syphilis bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass sich im Jahr 2022 circa acht Millionen Menschen mit dem Krankheitserreger infiziert haben. Die Syphilis wird praktisch ausschließlich durch sexuelle Kontakte übertragen. Das Bakterium nutzt dabei in der Regel kleinste Verletzungen in den natürlichen Schutzbarrieren von Haut und Schleimhäuten. Die Erkrankung kann mit Antibiotika behandelt werden.
„Die Möglichkeit, dieses Bakterium ohne den Einsatz von Labortieren zu kultivieren, bringt viele Vorteile für die Wissenschaft“, ergänzt Sabine Gronow. „Der Einsatz von Labortieren und der damit verbundene Aufwand sowie Leid entfällt. Bei der Kultivierung in der Petrischale ist das Bakterium einfacher zugänglich und somit viel leichter zu erforschen. Das ermöglicht den Forschenden, das Infektionsverhalten von T. pallidum und auch die Entwicklung neuer Therapieansätze zu erforschen.“ Bislang ist noch kein sogenannter Typstamm von T. pallidum subsp. pallidum beschrieben, der Stamm DSM 117211 soll zukünftig als solche Referenz für die Forscher gelten.