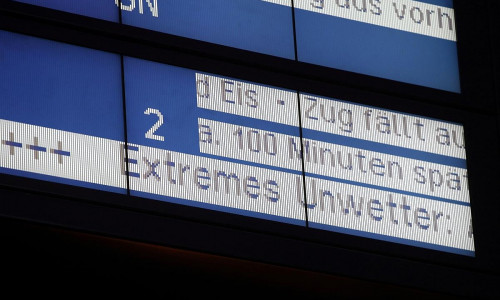Region. Immer mehr Menschen setzen auf das Heizen mit Holz - das Umweltbundesamt spricht von mehr als einem Viertel aller deutschen Haushalte. Das spart Energiekosten, doch sorgt es nicht immer für Freude bei den Nachbarn. Grund ist zum einen die Geruchsbelästigung und zum anderen werden auch immer mehr Stimmen zum Thema Feinstaubbelastung laut. Wie sieht es damit speziell in unserer Region aus? Und wie kann man die Feinstaubbelastung verringern?
Feinstaubbelastung auch in unserer Region?
„Die Überwachung der Luftqualität erfolgt nach festen Vorgaben hinsichtlich Art, Umfang und Qualität. Zuständig für die Überwachung ist das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim“, so Kornelia Vogt, Pressestelle Landkreis Wolfenbüttel. Die zulässigen Grenzwerte für Feinstaub seien seit 2006 nicht mehr überschritten worden. Vogt ergänzte: „Bei der Feinstaubbelastung handele es sich weniger um ein lokale Angelegenheit als eine regionale.“ Wolfenbüttel habe selber keine Messstation für Feinstaub, aber die Messstationen in Salzgitter-Drütte und Braunschweig seien repräsentativ. Was wird außerdem getan? Das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz hat dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim 2013 den Auftrag für den Beginn zur flächendeckenden Ermittlung von Luftschadstoff-Hotspots in Niedersachsen im Rahmen des Projektes HErmElin gegeben. Die Berechnungen dauern noch an, sie sollen am Ende potenzielle Feinstaub/ Stickstoffdioxid-Hotspots ermitteln, denen die jeweilige Kommune dann gezielt entgegen wirken kann.
Gesetzliche Auflagen
„Die Eigentümer von Grundstücken sind verpflichtet, die Reinigung und Überprüfung von kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen, zu denen die als Kamine / Kaminöfen bezeichneten Einzelraumfeuerungsanlagen gehören, durchführen zu lassen. Hierzu gehören auch die Messungen nach der 1. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“, so Kornelia Vogt, Pressestelle des Landkreises Wolfenbüttel.
Die ermittelten Messwerte seien laut Vogt entscheidend dafür, wie lange ein Ofen noch ohne emissionsbegrenzende Nachrüstung benutzt werden dürfe. Konnte ein Nachweis über die Einhaltung der Grenzwerte bis einschließlich 31.12.2013 nicht geführt werden, müssten diese nachgerüstet werden oder außer Betrieb genommen werden. Die Überprüfung der Einhaltung der erforderlichen Schornsteinfegerarbeiten erfolge durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Öfen die bis einschließlich 1984 gebaut wurden. Denn für sie besteht eine Austauschfrist bis zum 31. Dezember 2017. Es sei denn, sie halten die Grenzwerte ein oder werden nachgerüstet. Die nächste Frist läuft dann für Öfen der Baujahre 1985 bis 1994 am 31. Dezember 2020 ab.
Wie hoch sind die Grenzwerte?
Die Grenzwerte für die sogenannten Einzelraumfeuerungsanlagen oder -stätten, die ihren Betrieb vor dem Inkrafttreten der Verordnung am 22. März 2010 aufgenommen haben, liegen bei vier Gramm Kohlenmonoxid und 0,15 Gramm Staub pro Kubikmeter. Strenger sind die Werte für neuere Öfen: Zwischen März 2010 und Ende 2014 errichtete Anlagen haben Grenzwerte von zwei Gramm Kohlenmonoxid und 0,075 Gramm Staub pro Kubikmeter. Für nach 2015 in Betrieb genommene Öfen wurden die Grenzwerte noch einmal herabgesetzt: auf 1,25 Gramm Kohlenmonoxid und 0,04 Gramm Staub pro Kubikmeter.
Laut Umweltbundesamt gelten relativ niedrige Emissionsgrenzwerte für Holzpelletheizungen (je nach Errichtungsdatum 0,02 – 0,06 Gramm Staub pro Kubikmeter und 0,4 – 0,8 Gramm Kohlenmonoxid). Die Anforderungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ erfüllen besonders emissionsarme Holzpelletkessel und -öfen.
Spezialfall: Offener Kamin
Der offene Kamin kommt der ursprünglichen Art des Lagerfeuers am nächsten. Er bietet einen ungehinderten Blick auf die Flammen.
[image=3215 size-full alignnone]
Die Brenntemperatur ist durch die offene Bauweise geringer und führt zu einer, im Vergleich zu anderen Kaminformen, höheren Feinstaubbelastung. Das ist auch der Grund, weshalb offene Kamine laut Bundes-Immissionsschutzverordnung nur gelegentlich betrieben werden dürfen. Doch was ist unter gelegentlich zu verstehen? Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz beinhaltet eine Begrenzung der Betreibung auf monatlich acht Tage für jeweils fünf Stunden. Die Wärme, die von einem offenen Kamin erzeugt wird, verpufft bei einem Wirkungsgrad zwischen 15 und 30 Prozent nahezu. Somit handelt es sich bei offenen Kaminen im Grunde um reine Blickfänger mit aussterbendem Charakter. Ihre Existenz ist nur noch bis 2024 geduldet. Danach muss jeder Kamin mit einer Tür, einem Filter gegen Feinstaub und zulässigen Emissionswerten ausgestattet sein.
Eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Holzöfen und Kaminen haben wir Ihnen im Artikel „Angefeuert – Lagerfeuerromantik für Daheim“zusammengestellt.
Tipps zur Verringerung von Emissionen
Nur trockenes Holz verwenden
Bevor Holz seinen Weg in den Holzofen oder den Kamin findet, sollte es gut durchgetrocknet sein – ideal sind Feuchtegehalte von deutlich unter 20 Prozent.Ein Feuchtegehalt von höchstens 20-25 Prozent sollte nicht überschritten werden. Beim Verbrennen von Holz mit einer Restfeuchte von 25 Prozent im Vergleich zu Brennholz mit nur 14 Prozent Restfeuchte verdoppelt sich laut einer Ermittlung der Stiftung Warentest der Feinstaub-Ausstoß. Ein Verbrennen von Holz mit einer Feuchte von über 25 Prozent ist gesetzlich verboten. Feuchtigkeitsprüfer gibt es bereits ab etwa 20 Euro. Wie lange etwas gelagert werden muss, hängt immer von der Holzart ab. Je härter das Holz ist, umso länger dauert es in der Regel bis es trocken ist.
Pappe und Papier haben in einem Kaminofen nichts zu suchen: Sie produzieren zu viel Asche und Feinstaub.
Ofen nicht überladen
Das Holz, das im Ofen landet, sollte stets gespalten sein, damit es gleichmäßiger verbrennt. Zudem sollte der Ofen nicht überladen werden. Dies ist vor allem bei offenen Kaminen wichtig. Laut Faustregel entspricht ein Kilo Holz etwa vier Kilowatt Brennwert.
Feuer richtig anzünden
Je langsamer das Holz gerade zu Anfang abbrennt, desto mehr Emissionen durch unverbrannte Kleinstoffe werden in die Luft abgegeben. Daher ist eine ausreichende Luftzufuhr über den Luft-Regler wichtig. Eine gute Sauerstoffzufuhr kann auch über das richtige Einschichten des Brennmaterials erreicht werden. Das Holz sollte die Wände des Ofens nicht berühren und locker in den Brennraum eingelegt werden, damit das Feuer richtig Luft ziehen kann. Richtig eingestellt ist die Luftzufuhr laut Umweltbundesamt dann, wenn das Innere des Ofens hell und ohne schwarze Rußablagerungen bleibt.
Schornstein pflegen
Und auch das gehört dazu: Ein Schornstein, der an einen Holzofen oder Kamin angeschlossen ist, erfordert eine regelmäßige Wartung. Setzt sich im Ofenrohr oder Schornstein eine Rußschicht fest, so steigt der Emissionsausstoß deutlich. Je häufiger ein mit festen Brennstoffen betriebener Ofen benutzt wird, desto häufiger muss der Schornsteinfeger zur Reinigung kommen.