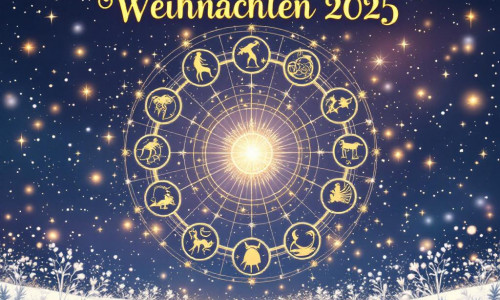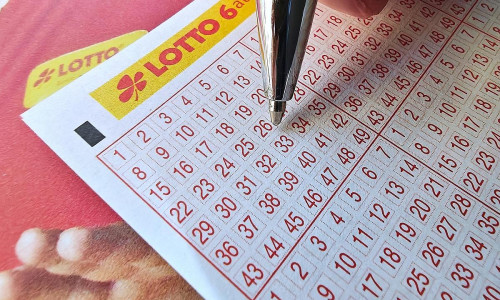Helmstedt. Ein dunkles Kapitel der DDR-Geschichte wurde kürzlich im Helmstedter Juleum beleuchtet. In Zusammenarbeit mit der Friedrich Naumann Stiftung hatte der Verein Grenzenlos zum Vortrag über die „Frauen von Hoheneck“ geladen.
Das ehemalige Gefängnis Schloss Hoheneck liegt im sächsischen Stollberg in der Nähe von Chemnitz und galt als Zuchthaus mit katastrophalen Haftbedingungen. Hier befand sich von 1950 bis 1989 das zentrale Frauengefängnis der DDR. Neben Schwerstkriminellen wurden auch Generationen von politischen Gefangenen in diesem Staatsgefängnis inhaftiert. Besondere Intensität erlangte der Abend, als zwei Zeitzeuginnen in der vollbesetzten Aula des Juleums ihre persönlichen Erfahrungen aus der Zeit ihrer Inhaftierung schilderten.
In ihren Grußworten brachten es Helmstedts Erster Stadtrat Henning Konrad Otto, Anne Vormelchert von der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Ehrenvorsitzende der FDP im Landkreis Helmstedt, Dr. Ulrich Dirksen, alle auf den gleichen Nenner: Demokratie sollte gelebt und vorgelebt werden und bedarf in der Gesellschaft Projekte und Initiativen, die sich dafür einsetzen.
Einblick in die Haftbedingungen
Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Impulsvortrag des sächsischen Historikers Sebastian Lindner. „Der politische Strafvollzug war ein wichtiges Instrument der SED zur Sicherung ihres Machtanspruches“ führte er aus. DDR-Gegner sollten auf diese Weise systematisch entfernt, eingeschüchtert und verwahrt werden. Um den Einfluss der politischen Häftlinge auf die restlichen Inhaftierten zu unterbinden, spann die Stasi ein dichtes Netz unter den Häftlingen und auch unter den Vollzugsbeamten. Jeder bespitzelte seinen Nächsten. Selbst der in der Haftanstalt tätige Pfarrer und der Anstaltsarzt wurden als inoffizielle Mitarbeiter eingesetzt.
In einem Kurzfilm mit dem bezeichnenden Namen „Kaputt“ erzählten inhaftierte Frauen eindrucksvoll von den unmenschlichen Erlebnissen und Haftbedingungen auf Hoheneck. Enge Zellen mit dreistöckigen Betten waren komplett überbelegt. Keine Privatsphäre in den Waschräumen und Beobachtung durch Spione an der gegenüberliegenden Wand. Die Inhaftierten wurden zur Zwangsarbeit gezwungen.
Zeitzeuginnen berichteten
Die Zeitzeuginnen Rosl Werl und Gabriele Stötzer erzählten anschließend ihre ganz eigenen persönlichen Erlebnisse. Rosl Werl wurde verurteilt, weil sie mehrfach einen Ausreiseantrag gestellt hatte, um ihre Urlaubsliebe aus Westdeutschland zu heiraten. Sie wurde unter dem Vorwand landesverräterischer Agententätigkeit zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Noch heute prägt die damalige Erfahrung ihr Leben. „Beklemmungsängste in dunklen und engen Gängen und Räumen gehören dazu ebenso wie mein verloren gegangener Orientierungssinn“ schildert sie. Rosl Werl arbeitet ihre Vergangenheit mit Hilfe von Zeugenzeugeninterviews aktiv auf und scheut nicht davor zurück, ihre Peiniger und Denunzianten von einst aufzusuchen.
Gabriele Stötzer hat sich 1976 an einer Unterschriftensammlung Berliner Künstler gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann beteiligt. Da sie als erste auf der Liste unterschrieb, galt sie als Kopf der feindlichen Gruppe. Wegen Staatsverleumdung wurde sie angeklagt und zu einem Jahr Haft verurteilt. Ihre Inhaftierung wird für sie zum Katalysator, sich ihren Traum vom Künstlerleben im realen Leben zu erfüllen. In ihren künstlerischen Arbeiten verarbeitet die Schriftstellerin und Künstlerin heute noch ihre Haft in Hoheneck.
Historiker Sebastian Lindner dankte den Zeitzeuginnen abschließend für ihre eindrucksvollen Berichte und ihre Bereitschaft, vor einem großen Publikum zu sprechen. Mit seinen Veranstaltungen möchte der Verein Grenzenlos auch weiterhin dafür werben, sich für das wichtige Gut „ Demokratie“ einzusetzen und diese zu leben.