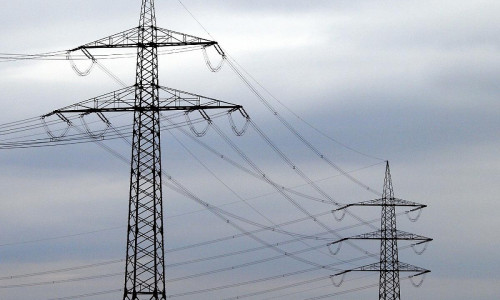Region. Gestern war Karfreitag. Dieser Tag gilt als einer der höchsten christlichen Feiertage – ein Tag der Trauer, der Besinnung und des Gedenkens an die Kreuzigung Jesu Christi. Doch was die meisten Menschen mit diesem Freitag vor Ostern verbinden: Tanzen ist verboten. So schreibt es das Niedersächsische Feiertagsgesetz.
Das sogenannte Tanzverbot am Karfreitag ist Teil des stillen Feiertagsgesetzes. Dies untersagt öffentliche Veranstaltungen, die nicht dem ernsten Charakter des Tages entsprechen – darunter vor allem Partys, Tanzveranstaltungen oder bestimmte Sport- und Unterhaltungsformate.
Was ist verboten?
In Niedersachsen schreibt das Niedersächsische Feiertagsgesetz vor, dass von Gründonnerstag, 5 Uhr, bis Ostersamstag 24 Uhr, öffentliche Tanzveranstaltungen verboten sind. Darüber hinaus gilt am Karfreitag, dass in Räumen mit Schankbetrieben sämtliche Veranstaltungen, die über die Abgabe von Speisen und Getränken hinausgehen (zum Beispiel Musikdarbietungen) nicht zulässig sind. Auch öffentliche sportliche Veranstaltungen sind untersagt. Genauso wie alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, außer wenn sie der geistig-seelischen Erhebung oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den ernsten Charakter des Tages Rücksicht nehmen.
Warum gibt es das Tanzverbot?
Hintergrund ist die religiöse Bedeutung des Tages. Der Karfreitag ist für Christen der Tag der Kreuzigung Jesu – ein Tag der Trauer, des Innehaltens und der Reflexion. Das Tanzverbot soll diesem Charakter Rechnung tragen und ein würdevolles öffentliches Gedenken ermöglichen. Doch das Gesetz betrifft alle Bürger – unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit. Und genau das sorgt immer wieder für Diskussionen.
Zwischen Tradition und Gegenwart
In einer Gesellschaft, in der viele Menschen keinen engen Bezug mehr zu Kirche und Religion haben, wird das Tanzverbot immer häufiger infrage gestellt. Kritiker argumentieren, dass staatlich verordnete religiöse Ruhe nicht mehr zeitgemäß sei. Sie sehen darin einen Eingriff in die persönliche Freiheit und fordern die Trennung von Kirche und Staat auch im Feiertagsgesetz.
Befürworter hingegen betonen die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung des Karfreitags. Ein Tag im Jahr, an dem das öffentliche Leben etwas langsamer und bewusster wird, sei ein wichtiges Zeichen – auch jenseits religiöser Überzeugung.
Was passiert bei Verstößen?
Wer sich nicht an das Verbot hält, riskiert Bußgelder. Diese können je nach Bundesland und Schwere des Verstoßes zwischen 500 und 2.500 Euro liegen.