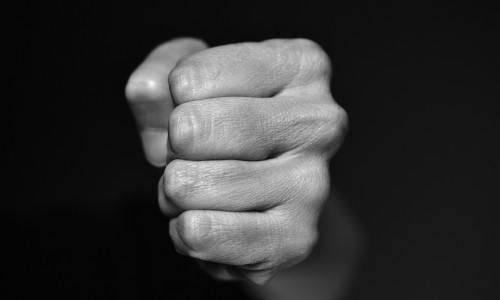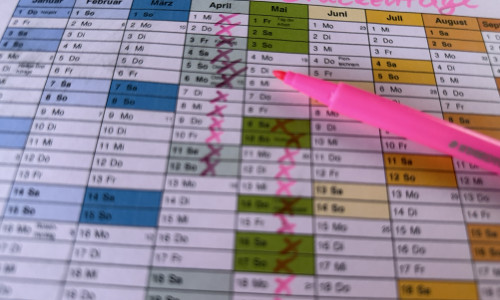Was die einen Freiheit nennen, empfinden andere als Entfremdung. Für viele ältere Menschen ist die digitale Welt ein Ort der Unsicherheit geworden - kalt, anonym, fehleranfällig. Arzttermine, Online-Banking, Fahrkarten: Der Fortschritt soll helfen, doch er grenzt aus, wenn niemand erklärt, wie er funktioniert.
„Mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung des Alltags warnen wir als Sozialverband VdK vor einer zunehmenden Ausgrenzung älterer und digital nicht versierter Menschen“, sagt Friedrich Stubbe, Landesvorsitzender des VdK Niedersachsen-Bremen. „Das Filialnetz der Banken dünnt immer weiter aus, Poststellen werden geschlossen, Arzttermine sind nur noch online vereinbar, diese Dinge zählen zur allgemeinen Daseinsvorsorge, zu der jeder Mensch Zugang haben sollte.“
Wenn Fortschritt zur Fremdsprache wird
Die Zahlen zeigen, wie groß das Problem ist: Laut dem Digitalverband Bitkom nutzt rund ein Drittel der über 65-Jährigen das Internet selten oder gar nicht. Das Statistische Bundesamt spricht von rund 2,8 Millionen Menschen in Deutschland, die vollständig offline leben. In Niedersachsen sind es Zehntausende, viele von ihnen im ländlichen Raum, wo Mobilität ohnehin schwierig ist.
Die Digitalisierung schreitet voran und zieht eine Schneise durch den Alltag vieler Älterer. Für die einen bedeutet sie Freiheit, für andere Einsamkeit. Wer früher im Schalterraum der Sparkasse ein vertrautes Gesicht traf, steht heute vor Bildschirmen, die keine Geduld kennen.
„Die stetige Verlagerung ins Digitale ist schlichtweg diskriminierend“, sagt Stubbe. Besonders im Gesundheitswesen wird die Kluft spürbar. Wer keinen Computer hat, bekommt keinen Arzttermin. Wer keine App bedienen kann, verliert den Anschluss an die medizinische Versorgung. Manche verzichten irgendwann ganz darauf, aus Scham oder Überforderung.
Stubbe spricht von einer „digitalen Mauer“, die langsam, aber spürbar wächst. „Gerade ältere und digital nicht versierte Personen, aber auch Menschen mit einer Behinderung sind von der fortschreitenden Digitalisierung hart getroffen.“ Er fordert ein „Nebeneinander von analogen und digitalen Angeboten“, als Zeichen des Respekts vor einer Generation, „die das Fundament dieser Gesellschaft gelegt hat“. Digitalisierung, sagt er, müsse auch Mitgefühl können: „Wer Teilhabe verspricht, darf keine Türen schließen.“
Die Sparkasse: Zwischen Online und Nähe
Bei der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) weiß man, dass Fortschritt nicht überall gleich ankommt. „Unsere Praxiserfahrung zeigt, dass viele ältere Kundinnen und Kunden unsere Online-Angebote nutzen und durchaus an den neuen digitalen Möglichkeiten interessiert sind“, sagt Marion Thomsen, Pressesprecherin der BLSK.
Doch Interesse allein reicht nicht. Mehr als 80 Mitarbeitende im Kundenservice-Center unterstützen täglich beim Einstieg ins Online-Banking – telefonisch, per Video oder persönlich. „Wir erklären, begleiten, nehmen Ängste ernst“, so Thomsen.
Zudem engagiert sich die Sparkasse mit ihrer Stiftung in Projekten, die Brücken zwischen den Generationen bauen: Schülerinnen und Schüler zeigen älteren Menschen den Umgang mit Smartphones, Apps und digitalen Diensten. Für Regionen, in denen Filialen geschlossen wurden, plant die BLSK einen Sparkassenbus, der Bargeld und Beratung direkt in die Dörfer bringt.
„Damit hoffen wir, denjenigen Menschen ein Angebot machen zu können, die im ländlichen Bereich vor der Umwandlung von Filialen betroffen sind“, erklärt Thomsen. „Unsere Kundinnen und Kunden wählen den Kommunikationskanal ganz nach ihren Wünschen – vor Ort, telefonisch oder online.“ Für die Bank ist das mehr als ein Service – es ist ein Bekenntnis zur Nähe.
Angst vor der digitalen Welt
Bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen zeigt sich täglich, wie dünn die Grenze zwischen Neugier und Überforderung ist. „Einige Ratsuchende trauen sich weniger, das Internet zu nutzen, andere vertrauen zu schnell und fallen auf Fake-Werbungen oder unseriöse Gesundheits- und Gewinnversprechen herein“, sagt Kathrin Bartsch, Referentin für Digitales und Telekommunikation.
In ihren Kursen erlebt sie Menschen, die mutig Neues lernen und solche, die sich in einer Welt voller Passwörter und Sicherheitsfragen verloren fühlen. „Viele sind sehr offen und bereit, sich einzulassen. Andere sind ängstlicher und möchten sich gar nicht so sehr mit den Themen beschäftigen.“
Manche sind gut vorbereitet, andere erzählen von falschen Gewinnversprechen. Bartsch kennt diese Mischung aus Neugier und Furcht gut. „Suchen Sie sich Hilfe und Unterstützung. In fast jedem Ort gibt es Verbände, Volkshochschulen oder Verbraucherzentralen, die regelmäßig Workshops anbieten. Und: Fragen, fragen, fragen – das gilt immer und für alle Altersgruppen.“
Für viele sei das der erste Schritt aus der Angstzone. „Digitale Bildung ist kein Luxus“, sagt Bartsch, „sie ist Voraussetzung, um im Alltag selbständig zu bleiben.“
Was Senioren jetzt tun können
In ganz Niedersachsen wächst das Netz an Hilfsangeboten, Kursen und Initiativen. Volkshochschulen bieten spezielle Digitalkurse für Seniorinnen und Senioren an – praxisnah, langsam, barrierefrei. Dort lernen Teilnehmende, wie man E-Mails schreibt, Online-Banking sicher nutzt oder Arzttermine digital bucht.
Verbraucherzentralen und Seniorenbeiräte klären über Internetbetrug, Datenschutz und digitale Vorsorge auf. In Generationencafés zeigen Jugendliche älteren Menschen, wie Apps funktionieren und hören im Gegenzug Geschichten, die kein Algorithmus kennt.
Auch Banken reagieren zunehmend. Die Sparkassen setzen auf Hybridmodelle aus persönlicher Beratung und digitaler Unterstützung. Einige haben sogar eigene „Digital-Lotsen“, die Schritt-für-Schritt erklären, wie Online-Banking funktioniert.
„Digitale Kompetenz ist keine Frage des Alters, sondern des Zutrauens“, sagt Bartsch. Wer sich traut, Fragen zu stellen, verliert die Angst und gewinnt Selbstständigkeit zurück.
Ein Land zwischen WLAN und Wirklichkeit
Deutschland digitalisiert sich, aber nicht gleichmäßig. In den Städten wachsen Glasfasernetze, auf dem Land bleiben Funklöcher. Zwischen E-Government und Sparkassenbus, zwischen App und Formular spielt sich ein Generationendrama ab: Wie modern darf ein Land werden, ohne seine Ältesten zu verlieren?
„Anstelle von Schließungen sollten Banken über alternative Lösungen nachdenken wie Beratung auf Abruf, mobile Filialen oder das Teilen von Standorten“, fordert Stubbe. Digitalisierung sei mehr als Technik – sie sei Haltung.
Denn Teilhabe beginnt nicht bei der App, sondern bei der Bereitschaft, Menschen mitzunehmen. Fortschritt, so scheint es, ist erst dann vollständig, wenn er allen zugutekommt, auch denen, die keinen WLAN-Hotspot besitzen.
Fortschritt mit Menschlichkeit
Vielleicht braucht es weniger neue Plattformen und mehr alte Tugenden: Geduld, Zeit, Respekt. Für viele Ältere ist ein freundlicher Satz am Telefon wertvoller als jede digitale Anleitung. „Unsere Kundinnen und Kunden wählen den Kommunikationskanal ganz nach ihren Wünschen“, sagt Thomsen. Diese Wahlfreiheit ist kein technisches Detail, sie ist das Versprechen, dass Fortschritt nicht auf Kosten derer geht, die ihn einst ermöglicht haben.
Digitalisierung kann verbinden oder spalten. Entscheidend ist, wie sie gestaltet wird. Für viele ältere Menschen geht es nicht darum, perfekt zu werden, sondern nicht vergessen zu werden. Denn am Ende ist der größte Fortschritt der, der niemanden zurücklässt.