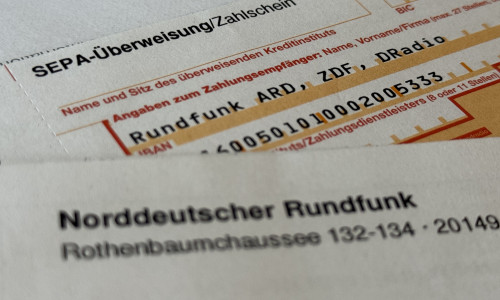Goslar. Im Januar starteten das Forschungszentrum Energiespeichertechnologien (EST) der Technischen Universität (TU) Clausthal und die Freiwillige Feuerwehr Goslar im Rahmen einer Auftaktveranstaltung im EST die gemeinsame Projektarbeit zur Feuer- und Gefahrenabwehr havarierter Lithium-Ionen-Batterien. Darüber berichtet die Feuerwehr Goslar in einer Pressemitteilung.
Nach mehreren Jahren Vorbereitung und Einwerbung von Fördermitteln könne ein nicht nur für die Feuerwehren wichtiges Projekt aufgenommen werden. Neben Vertretern der TU und der Stadt Goslar unterstrichen auch Vertreter des Niedersächsischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) die Wichtigkeit der begonnenen Forschungsarbeit.
Mehrere Förderer
Das Projekt LiBattFire (Lithium-Ionen-Batterien Feuer- und Gefahrenabwehr) ist auf 30 Monate ausgelegt. Beteiligt sind daneben die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) sowie die Berufsgenossenschaft für Energie, Textil, Elektro und Medienerzeugnisse (BG ETEM). Die DGUV fördert das Projekt mit 240.000 Euro.
Lithium-Ionen-Batterien haben auf Grund ihrer vergleichsweisen hohen Energie- und Leistungsdichte sowie der langen Lebensdauer Einzug in fast alle Bereiche des täglichen Lebens gefunden. Mit der weiten Verbreitung seien, trotz dieser grundsätzlich sicheren Technologie, Schadensfälle nicht komplett auszuschließen. Fertigungsfehler, Druck und Stöße, zu hohe Temperaturen oder Fehlbetrieb könnten in seltenen Fällen durchaus zu Bränden oder Explosionen mit dem damit verbundenen Austreten giftiger Gase führen, so die Feuerwehr.
Keine übervorsichtigen Einsatzstrategien
Feuerwehren und auch andere Organisationen und Berufszweige, die sich mit der Bekämpfung oder der Beseitigung von Batteriebränden beschäftigen, stünden der noch relativ neuen Gefahr mit einer gewissen Unsicherheit gegenüber. Übervorsichtige Einsatzstrategien verbunden mit einer möglicherweise verzögerten Personenrettung und Sicherung von Sachwerten sollten vermieden werden. Mögliche unterschätzte Gefahren mit negativen Folgen für Einsatzkräfte und Einsatzmittel seien gar auszuschließen.
Das jetzt gestartete Forschungsprojekt „LiBattFire“ hat zum Ziel, eine gesichertere Informationslage bei der Ausgangssituation von mit Lithium-Ionen-Batterien konfrontierten Einsatzkräften und Berufsgruppen zu erhalten. Gemeinsam mit der Feuerwehr Goslar als Projektpartner soll durch die Forschung in den kommenden Monaten sichergestellt werden, dass neuartige und möglicherweise noch nicht bekannte Gefahren im Schadensfall von Lithium-Ionen-Batterien erkannt und korrekt eingeschätzt werden. So sollen Gefährdungen schnell gemindert und Auswirkungen auf die Gesundheit der beteiligten Personen ausgeschlossen beziehungsweise minimiert werden.
Möglichst standardisiertes Vorgehen
Die Sensibilisierung für potentielle Risiken soll durch exemplarische Handlungsempfehlungen ergänzt werden, sodass der Unsicherheit im Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien durch ein wissenschaftlich fundiertes, möglichst standardisiertes Vorgehen begegnet werden kann. Unverhältnismäßige Aktionen, wie das „Versenken“ eines E-Autos nach einem Unfall ohne Batterieschädigung in einem mit Wasser gefülltem Container soll genauso vermieden werden, wie das Unterschätzen der Gefahr eines E-Autobrandes in einer Tiefgarage oder eines Speichers für Sonnenstrom im heimischen Keller.
Kontaminationen durch Brandgase
Ein Projektziel ist darüber hinaus die Bestimmung der Kontaminationen durch Brandgase und Partikel der Umgebung und der persönlichen Schutzausrüstung eingesetzter Einsatzkräfte nach dem Schadensereignis. So ist bekannt, dass beispielsweise Schwermetalle wie Mangan, Kobalt und Nickel bei einem Brand freigesetzt werden können. Nach dem jetzigen Wissensstand wird die Einsatzkleidung nach einem Brand vielfach entsorgt, ohne dass dieses möglicherweise zwingend notwendig wäre. Überdies sollen die Erkenntnisse in eine standarisierte Ausbildung der Feuerwehrangehörigen im Löscheinsatz einfließen.
Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner begrüßt das Projekt. „Die Lithium-Ionen-Batterien sind im alltäglichen nicht mehr Wegzudenken. Wir müssen aber einen Weg finden, um unsere Einsatzkräfte bestmöglich zu schützen und auszubilden“, so Schwerdtner. Für Oliver Moravec und Mathias Bunzel vom Niedersächsischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) besteht ein großes Interesse an den zu erwartenden Erkenntnissen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Feuerwehr wird sehr positiv betrachtet.
Fragenkatalog der Feuerwehr
Seitens der Brandschützer freuen sich Stadtbrandmeister Christian Hellmeier und der designierte Kreisbrandmeister und derzeitige Goslarer Ortsbrandmeister Udo Löprich darüber, dass nunmehr konkrete und fundierte Lösungsansätze für den zukünftigen Umgang havarierter Lithium-Ionen-Batterien erarbeitet werden können. Laut Löprich liegt ein großer Fragenkatalog vor: Wie ist mit E-Fahrzeugen in Tiefgaragen und Parkhäusern, in Garagen inmitten von Altstädten umzugehen? Wie können gesundheitliche Gefahren von Einsatzkräften, die Vermeidung von Trinkwasserverunreinigungen durch mögliche fehlende Löschwasserrückhaltung und die Kostenminimierung von verunreinigter Einsatzbekleidung bei Vermeidung ständiger Entsorgung begegnet werden? Wie kann die Bevölkerung im Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien und deren Lagerung sensibilisiert und der vorbeugende Brandschutz bereits verbessert werden? Welche Schritte sind in der Ausbildung von Feuerwehrkräften zu berücksichtigen?
Löprich stand im Jahr 2021 bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus als Einsatzleiter vor einer großen Herausforderung. Ausgangssituation des Brandes war ein technischer Defekt beim Ladevorgang eines Lithium-Ionen-Akkus für ein E-Bike. Dies veranlasste Löprich den verantwortlichen Projektleiter und selbst Feuerwehrmann Dr. Ralf Benger vom EST zu kontaktieren. Der Projektgedanke war geboren, die Finanzierung veranlasste die Beteiligten jedoch in Geduld. Nun sehen aber sowohl Benger und Löprich sich in Ihrer Sicht der Gefahrenabwehr gestärkt und bestätigt.